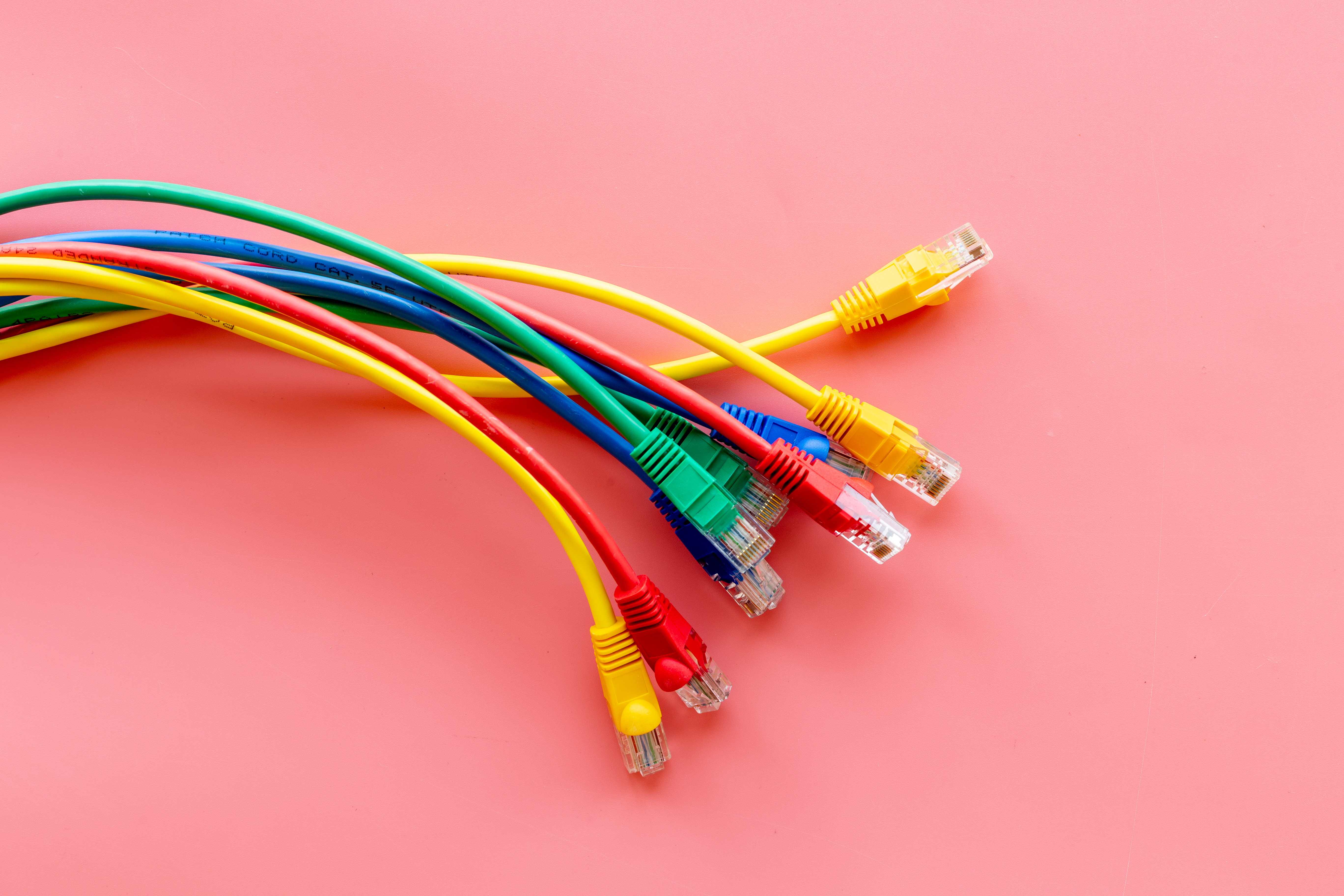Der große Wurf zur Modernisierung des Zivilverfahrensrechts? Eine Analyse des Koalitionsvertrags
Der am 5. Mai 2025 unterzeichnete Koalitionsvertrag der kommenden Bundesregierung sieht einige ambitionierte Reformen im Zivilverfahrensrecht vor. Erfreulich aus praktischer Sicht ist, dass sich der Koalitionsvertrag vielfach an den Resultaten der Reformkommission „Zivilprozess der Zukunft“ („Reformkommission“), deren Abschlussbericht am 31. Januar 2025 vorgestellt wurde, orientiert. Ziel ist eine Justiz, die mithilfe digitaler Lösungsansätze bürgernäher, schneller und effizienter arbeiten soll. Nicht nur Verbraucher, sondern auch Unternehmen werden die Auswirkungen dieser Reformen spüren, insbesondere im Bereich der strategischen Prozessführung und im Bereich der Massenverfahren.
Dieser Beitrag geht auf die wesentlichen geplanten Reformen im Zivilverfahrensrecht und ihre Auswirkungen auf die Unternehmenspraxis ein.
Digitalisierung der Justiz
Die Digitalisierung der Justiz wird im Koalitionsvertrag gleich an mehreren Stellen genannt und ist Kern der geplanten Modernisierung des Verfahrensrechts. Nach Einführung der elektronischen Akte (verpflichtend ab spätestens 1. Januar 2026, § 298a Abs. 1a S. 1 ZPO), des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs sowie der Ausweitung der Möglichkeit von Videoverhandlungen (§ 128a ZPO) will die Politik nun einen nächsten Schritt gehen, um das Zivilverfahrensrecht an die technologischen Realitäten des 21. Jahrhunderts anzupassen. Ziel ist eine – auch für den Bürger – digital erreichbare Justiz, die ihre Ressourcen optimal ausnutzen soll.
„Justizportal“ und „Bundesjustizcloud“
Im Koalitionsvertrag ist der Ausbau digitaler Kommunikationswege vorgesehen. Ein „Justizportal“ mit „Kommunikationsplattform, Vollstreckungsregister und weiteren Bürgerservices“ soll Bürgern und Unternehmen den Zugang zum Recht erleichtern. Auch innerhalb der Justiz selbst soll modernisiert werden: Die sogenannte „Bundesjustizcloud“ soll einen sicheren, einheitlichen Dokumentenaustausch zwischen Gerichten und Behörden ermöglichen.
Einführung von Online-Verfahren
Bereits in der letzten Legislaturperiode wurde ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung „zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit“ diskutiert. Der Koalitionsvertrag greift das Vorhaben erneut auf und formuliert unmissverständlich das Ziel: „Wir werden ein Online-Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit einführen“. Ob solche Online-Verfahren zunächst nur an Amtsgerichten und nur für Verfahren gerichtet auf Zahlung einer Geldsumme – so der Gesetzesentwurf der letzten Legislaturperiode – oder auch an Landgerichten und für eine Vielzahl an Verfahren eingeführt werden sollen, bleibt abzuwarten.
Online-Verfahren könnten in Zukunft einen niederschwelligen digitalen Zugang zur Justiz bieten. Der Abbau von Zugangshemmnissen könnte gleichzeitig die Anzahl eingehender Klagen deutlich erhöhen. Unternehmen könnten dadurch womöglich vermehrt Klagen ausgesetzt sein, etwa im Bereich von Verbraucher-, Datenschutz- oder von ESG-Streitigkeiten. Nicht zuletzt für Klägerkanzleien bietet eine möglichst medienbruchfreie Verfahrensführung weitere Einspareffekte, so dass zu befürchten ist, dass Klägerkanzleien ihr bisheriges Geschäftsmodell auf andere Rechtsbereiche ausdehnen.
Künstliche Intelligenz in der Justiz
Künstliche Intelligenz soll auch in der Justiz eingesetzt werden können. Natürlich kann KI nicht den Richter ersetzen (Art. 92 GG). Zu denken wäre aber – sofern auch hier dem Abschlussbericht der Reformkommission gefolgt wird – an den Einsatz von KI in einfacheren Prozessen wie zum Beispiel der Entscheidung über Prozesskostenhilfe, Rechtspflegertätigkeiten oder Geschäftsstellenaufgaben.
Effizientere Verfahren
Neben der Effizienz durch eine Digitalisierung der Justiz deutet der Koalitionsvertrag auch eine strukturelle Effizienzsteigerung der Verfahrensführung an. Verfahren sollen durch eine aktivere richterliche Steuerung effizienter und zielgerichteter gestaltet werden. Dazu sollen neue gesetzliche Grundlagen geschaffen werden – etwa für Verfahrenskonferenzen und Vorgaben zur Strukturierung des Parteivortrags. Auch damit greift der Koalitionsvertrag Empfehlungen der Reformkommission auf.
Verfahrenskonferenzen
Verfahrenskonferenzen sollen künftig frühzeitig den Verfahrensablauf klären und den Streitstoff strukturieren. Aus praktischer Sicht ist die gesetzlich verankerte Einführung von Verfahrenskonferenzen sehr zu begrüßen. Verfahrenskonferenzen sind bislang vor allem in Schiedsverfahren üblich, werden jedoch vereinzelt auch bereits jetzt in der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingesetzt. Explizit vorgesehen ist ein „Organisationstermin“ seit 1. April 2025 für Verfahren vor dem Commercial Court (§ 612 ZPO). Durch die gesetzliche Verankerung der Möglichkeit einer Verfahrenskonferenz für alle Verfahrensarten würde diesem sinnvollen Instrument eine viel größere Wirkung zukommen. Besonders in komplexen Streitigkeiten zwischen Unternehmen, die nicht vor einem Commercial Court geführt werden, sind durch Strukturierung und gegebenenfalls Abschichtung des Streitstoffes positive Effekte zu erwarten.
Strukturierter Parteivortrag
Wesentlich auf dem Abschlussbericht der Reformkommission basierend dürfte das Ziel des Koalitionsvertrags sein, dass Gerichte auch die Möglichkeit erhalten sollen, Vorgaben zur Strukturierung des Parteivortrags zu machen. Dadurch könnten unstrukturierter Parteivortrag und ausufernde Beweisanträge – insbesondere in der ersten Instanz – eingedämmt werden. Die Missachtung richterlicher Strukturierungsvorgaben könnte, wie im Bericht der Reformkommission angeregt, mit Sanktionen belegt werden. Allerdings bleibt offen, wie dies konkret umgesetzt wird.
Aus anwaltlicher Sicht ist einer zu starken, einseitigen Aufoktroyierung der Struktur des Parteivortrags durch das Gericht allerdings – auch mit Blick auf den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) – kritisch zu begegnen. Es bleibt abzuwarten, wie die Politik den Balanceakt zwischen Effizienzsteigerung und berechtigten Rechtsschutzinteressen der Parteien umsetzt. Aus praktischer Sicht dürfte sich zudem die Frage stellen, wie Gerichte mit der stärkeren Strukturierung umgehen. Strukturierung setzt eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Streitstoff voraus. Nicht selten erfolgt diese in der Praxis aber erst kurz vor dem Termin. Wird diese Arbeitsweise beibehalten, laufen auch die Strukturierungsmöglichkeiten ins Leere.
Ausweitung der Präklusionsfristen
Im Koalitionsvertrag ist weiterhin die Absicht formuliert, Präklusionsfristen auszuweiten, d.h. zeitliche Begrenzungen zu setzen, bis wann Parteien ihre Argumente und Beweismittel vorbringen müssen. Auch solche Instrumente sind in Form von sog. „cut-off dates“ häufig bereits in Schiedsverfahren zu finden. Die Reformkommission hat in ihrem Abschlussbericht mehrere Ideen dahingehend formuliert, wie eine Ausgestaltung im Einzelnen aussehen könnte. Konkrete Andeutungen zur Umsetzung im staatlichen Verfahren findet man im Koalitionsvertrag jedoch keine.
Die Ausweitung von Präklusionsfristen bringt für die Parteien eines Zivilverfahrens Vorteile aber auch Herausforderungen mit sich: Die Verfahrensdauern könnten erheblich verkürzt werden. Gleichzeitig wird aber ein besonderes Augenmerk auf die frühzeitige und vollständige Aufarbeitung des Sachverhalts zu legen sein. Die damit einhergehende Unterstützung der jeweils mit dem Inhalt der Streitigkeit befassten Fachabteilung im Unternehmen ist dann unerlässlich, um den Prozesserfolg nicht bereits aufgrund von Präklusionsvorschriften zu torpedieren.
Effektivere Klagezustellung in Europa
Im Koalitionsvertrag heißt es weiterhin: „Effektivere Klagezustellungen innerhalb Europas wollen wir sicherstellen.“ Dieser Vorschlag ist sicherlich zu begrüßen, denn Deutschland schöpft bereits die mit der maßgeblichen Verordnung (EU) 2020/1784 (EuZVO) geschaffenen Möglichkeiten nicht voll aus. So bleibt beispielsweise die durch die EuZVO eröffnete Möglichkeit zur Erweiterung der unmittelbaren Zustellung ungenutzt.
Verbesserungsbedarf besteht auch im innerstaatlichen Rechtsverkehr. So hat die Reformkommission zu Recht die Abschaffung des elektronischen Empfangsbekenntnisses (eEB) gefordert. Der Zugang eines Schriftstücks wird durch die automatisierte Eingangsbestätigung bereits zuverlässig nachgewiesen. Entsprechend § 173 Abs. 4 S.4 ZPO könnte der Zugang nach Ablauf einer bestimmten Anzahl an Tagen fingiert werden. Dazu verhält sich der Koalitionsvertrag nicht.
Schätzungs- und Pauschalierungsbefugnisse in Massenverfahren
Der Koalitionsvertrag nennt ferner die Bestrebung „Schätzungs- und Pauschalierungsbefugnisse“ zu stärken. Schätzungs- und Pauschalierungsbefugnisse helfen zwar, den gesamten Prozess zu vereinfachen und eine schnellere Entscheidung herbeizuführen. Allerdings bestehen solche Befugnisse bereits heute. Dass die Gerichte von diesen Befugnissen auch (verstärkt) Gebrauch machen, zeigt nicht zuletzt die BGH-Entscheidung aus jüngerer Zeit zum Anspruch aus Art. 82 DSGVO in Zusammenhang mit den Scraping-Vorfällen bei Meta. Wie die Ausweitung von Schätzungs- und Pauschalierungsbefugnissen konkret aussehen soll, bleibt abzuwarten.
Rolle der ersten Instanz ausbauen
Im Rahmen der angestrebten Reformen wird die Stärkung der ersten Instanz vorangetrieben. Die Streitwertgrenzen bei den Amtsgerichten sollen angehoben und der Zugang zur 2. Instanz begrenzt werden, wodurch die erste Instanz an Bedeutung gewinnt.
Anhebung der Streitwerte
Im Koalitionsvertrag ist die Anhebung der Streitwertgrenze bei den Amtsgerichten ausdrücklich vorgesehen. Bereits in der letzten Legislaturperiode war eine Erhöhung der Streitwertgrenze in § 23 Nr. 1 GVG von EUR 5.000 auf EUR 8.000 geplant. Ziel der Anhebung ist die Stärkung der Amtsgerichte, deren Eingangszahlen seit Jahren rückläufig sind. Die letzte Anpassung der Streitwertgrenze auf DM 10.000 erfolgte 1993 und wurde zum Zeitpunkt der Euro-Einführung schlichtweg umgerechnet übernommen. Die Anpassung der Streitwertgrenze ist somit zwar längst überfällig, nicht zuletzt, um auch in Massenverfahren die Landgerichte zu entlasten. Andererseits bleibt gerade in Massenverfahren abzuwarten, welche Dynamik sich aus der Anhebung der Streitwertgrenze entwickeln könnte. Durch die erstinstanzliche Anbindung weiterer Verfahren bei den Amtsgerichten besteht die Gefahr einer noch größeren Zersplitterung von Entscheidungen. Das neu eingeführte Leitentscheidungsverfahren beim BGH (§§ 552b, 565 ZPO) würde insoweit auch ins Leere laufen, da bei erstinstanzlicher Entscheidung des Amtsgerichts eine Revision zum BGH nicht möglich ist.
Begrenzung des Zugangs zur 2.Tatsacheninstanz
Mit Blick auf die Einlegung von Rechtmitteln höchst relevant ist das Ziel im Koalitionsvertrag „Rechtsmittelstreitwerte“ zu erhöhen und den „Zugang zu[r] zweiten Tatsacheninstanz [zu] begrenzen“. Unklar ist, was die Parteien des Koalitionsvertrags unter „Rechtsmittelstreitwerten“ verstehen. Vermutlich ist damit der Wert des Beschwerdegegenstandes gemeint, der bis dato für die Berufungsinstanz bei EUR 600 liegt und im Rahmen einer Nichtzulassungsbeschwerde der Revision EUR 20.000 übersteigen muss. Es bleibt abzuwarten, wie die zukünftigen Regierungsparteien die konkrete Umsetzung planen. Trotz potenzieller Beschleunigungseffekte sollte hier mit Bedacht agiert werden, um dem rechtlichen Gehör und den Rechtsschutzmöglichkeiten der Parteien nicht zu schaden.
Weitere Bestrebungen im Verfahrensrecht
Neben den konkret benannten Bestrebungen ist mit weiteren Reformen im Zivilverfahrensrecht zu rechnen. Allen voran nimmt der Koalitionsvertrag global auf den Abschlussbericht der Reformkommission „Zivilprozess der Zukunft“ Bezug und lässt erahnen, dass weitere Vorschläge der Reformkommission umgesetzt werden sollen. Aus unserer Sicht begrüßenswert wäre vor allem die im Abschlussbericht vorgeschlagene Einführung eines digitalen Beweisverzeichnisses. In diesem sollen Gericht, Aktenzeichen und Beweisthema des Ausgangsverfahrens aufgenommen werden und Parteien anderer Verfahren bei Darlegung eines berechtigten Interesses zugänglich gemacht werden. Damit könnten Beweismittel aus Parallelverfahren oder Vorprozessen systematisch erfasst und genutzt werden. Für Unternehmen, die regelmäßig mit Massenklagen konfrontiert sind, birgt das ein enormes Potenzial: Beweismittel müssten nicht mehrfach erhoben werden, was Prozesse effizienter gestaltet, Kosten reduziert und Ressourcen schont.
Außerdem fordert die Kommission die schrittweise Einführung einer bundeseinheitlichen Veröffentlichungspflicht für grundsätzlich alle zivilgerichtlichen Entscheidungen. Diese soll nicht nur Transparenz gewährleisten, sondern vor allem eine Grundlage für die Entwicklungen neuer Innovationen im Legal-Tech Bereich bilden.
Auch zu begrüßen wäre die Umsetzung der im Abschlussbericht vorgesehenen Stärkung und Modernisierung der Handelskammern. Ziel ist die Sicherung der Qualität der Rechtsprechung und Rechtsfortbildung.
Fazit
Die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Maßnahmen zur Modernisierung des Zivilverfahrensrecht und die Implementierung von aus Schiedsverfahren bekannten Instrumenten stellen einen vielversprechenden Schritt in Richtung einer zukunftsfähigen und effizienten Justiz dar.
Allerdings gehen die Reformvorhaben auch mit Herausforderungen einher. Für Unternehmen birgt der vereinfachte Zugang und die Erhöhung der Streitwerte vor den Amtsgerichten die Gefahr, vermehrt Klagen ausgesetzt zu sein, vor allem im Bereich von Verbraucher-, Datenschutz- oder ESG Streitigkeiten. Zugleich bleibt die Zersplitterung der Rechtsprechung ein relevantes Thema, da divergierende Entscheidungen weiterhin möglich sind, und sich das Risiko bei Erhöhung der Zuständigkeitsstreitwerte an den Amtsgerichten womöglich noch erhöht.
Dennoch bietet die Verfahrensmodernisierung und die zunehmende Digitalisierung auch erhebliche Chancen, insbesondere wenn Unternehmen ihre Prozessführung an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. Bei Einführung der Reformvorhaben ist eine erhöhte Wachsamkeit und frühzeitige präzise Auseinandersetzung mit dem Prozessstoff gefordert. Nur wer den Verfahrenslauf proaktiv steuert und die neuen Möglichkeiten genau auszuspielen weiß, kann die Chancen der Reform nutzen und zugleich Risiken minimieren.
Abschließend lässt sich sagen, dass der Koalitionsvertrag einen ambitionierten Schritt in Richtung einer digitalisierten Justiz darstellt, deren konkrete Auswirkungen auf die Prozessführung aber sorgfältig beobachtet und vorausschauend umgesetzt werden müssen.